Wirksamkeitsprüfungen von Gefährdungsbeurteilungen
Facility Management: Betreiberverantwortung » QMS » Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) » Wirksamkeitsprüfung
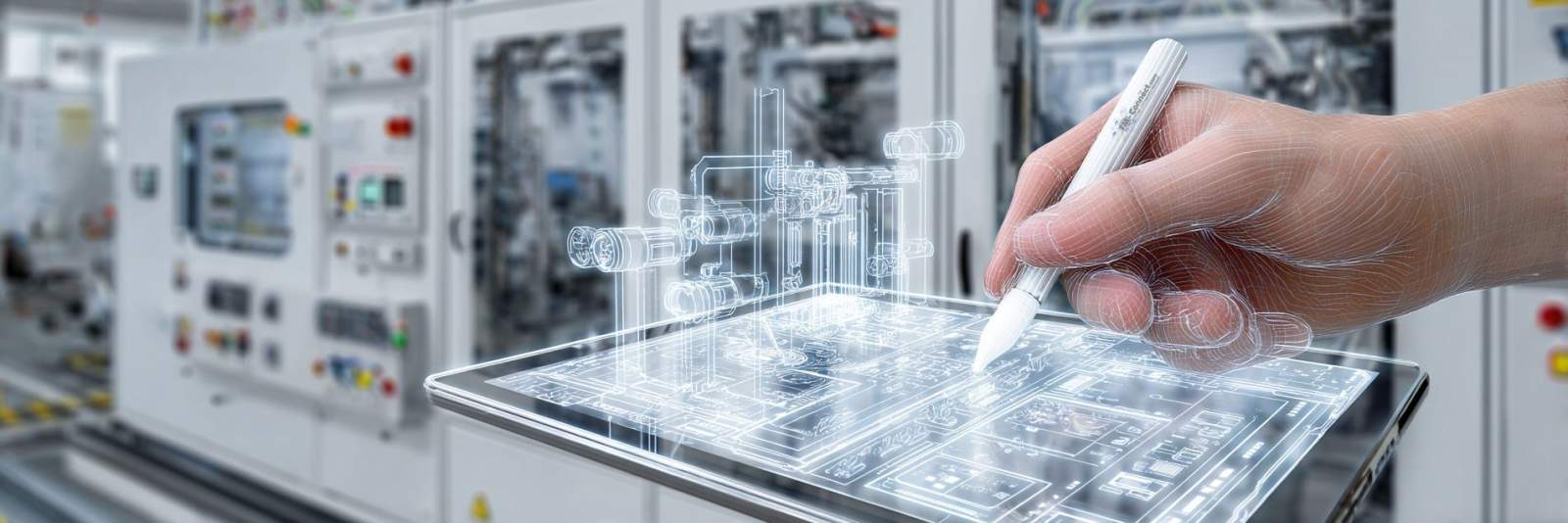
Wirksamkeitsprüfungen von Gefährdungsbeurteilungen
Im Facility Management (FM) stellt die Gefährdungsbeurteilung ein zentrales Element des Arbeitsschutzes dar. Diese wissenschaftlich-theoretische Untersuchung beleuchtet interdisziplinär, wie die Wirksamkeit der im FM erstellten Gefährdungsbeurteilungen überprüft werden kann. Berücksichtigt werden die rechtlichen Rahmenbedingungen (u. a. Arbeitsschutzgesetz, DGUV-Vorschriften, Arbeitsstättenregeln und DIN-Normen), organisatorische Aspekte sowie einschlägige Managementsysteme (z. B. ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagement und ISO 41001 für Facility-Management-Systeme). Technische und infrastrukturelle Herausforderungen im FM – von der Betreiberverantwortung über Instandhaltung und Reinigung bis zur Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern – werden ebenso analysiert. In all diesen Bereichen muss der Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten und Nutzer gewährleistet sein – eine Verpflichtung, die national wie international gesetzlich verankert ist. In Deutschland verpflichtet §5 des Arbeitsschutzgesetzes jeden Arbeitgeber, für alle Tätigkeiten eine Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen durchzuführen. Aus dieser Gefährdungsbeurteilung sind geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten, umzusetzen und auf ihre Wirksamkeit zu kontrollieren. Ebenso fordern die Unfallversicherungsträger (DGUV Vorschrift 1, §3) explizit, dass die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und bei Bedarf angepasst werden.
Theoretischer Hintergrund
Rechtliche Rahmenbedingungen der Gefährdungsbeurteilung im FM
Die Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich fest verankert und bildet die Grundlage für präventiven Arbeitsschutz in allen Branchen – so auch im Facility Management. In Deutschland stellt das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die maßgebliche Rechtsgrundlage dar. §5 ArbSchG verpflichtet Arbeitgeber, Gefährdungen der Beschäftigten vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, um daraus Schutzmaßnahmen abzuleiten. Dabei greift das Gesetz das Prinzip des vorbeugenden Handelns auf: Gefahren sollen identifiziert und entschärft werden, bevor Schäden eintreten. Ergänzend fordert §6 ArbSchG die Dokumentation der Ergebnisse. Weitere Verordnungen präzisieren diese Pflichten, etwa die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für Arbeitsmittel und Anlagen, die Gefahrstoffverordnung für den Umgang mit Gefahrstoffen oder die Arbeitsstättenverordnung, welche für sichere Arbeitsbedingungen in Gebäuden sorgt. Auch das Sozialgesetzbuch (SGB VII) und branchenspezifische Regeln der Unfallversicherer enthalten Vorschriften zur Gefährdungsbeurteilung, insbesondere für Bereiche des öffentlichen Dienstes, Bildungseinrichtungen etc..
Für die Wirksamkeitsprüfung ist besonders die DGUV Vorschrift 1 („Grundsätze der Prävention“) relevant. Diese Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften übernimmt die ArbSchG-Vorgaben und konkretisiert: „Die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen.“. Praktisch bedeutet dies, dass jedes Unternehmen – und damit auch jeder Facility-Management-Bereich – ein Verfahren etablieren muss, um nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen deren Erfolg zu kontrollieren. Die Berufsgenossenschaften geben hierzu Hilfestellungen in Form von Branchenregeln, Checklisten und Beratung durch Aufsichtspersonen.
Ein wichtiger rechtlicher Aspekt im FM ist die sogenannte Betreiberverantwortung. Betreiber von Anlagen und Gebäuden (z. B. Eigentümer oder Facility-Manager im Auftrag des Eigentümers) tragen eine besondere Pflicht, ihre Liegenschaften sicher zu betreiben. Diese Verantwortung wird in technischen Regelwerken (etwa VDI 3810 für gebäudetechnische Anlagen) und Rechtstexten (z. B. in der BetrSichV oder im Baurecht) beschrieben. Im Kern bedeutet Betreiberpflicht: Alle gesetzlichen Prüfungen und Sicherheitsmaßnahmen müssen fristgerecht durchgeführt und überwacht werden. Dazu zählt explizit auch, Gefährdungen zu beurteilen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen sowie die Ergebnisse zu dokumentieren. Vernachlässigt ein Betreiber diese Pflichten, drohen Haftungsrisiken. Im FM-Umfeld kommt hinzu, dass Betreiberpflichten oft delegiert werden – z. B. vom Eigentümer an einen FM-Dienstleister. Gleichwohl bleibt die Pflicht zur Wirksamkeitskontrolle bestehen: Wer Aufgaben delegiert, muss kontrollieren, ob der Beauftragte sie auch wirksam erfüllt.
Integration von Arbeitsschutz ins Facility Management
Neben gesetzlichen Vorgaben spielen Managementsysteme eine zentrale Rolle, um Gefährdungsbeurteilungen systematisch umzusetzen und ihre Wirksamkeit zu überwachen. International hat sich insbesondere die Norm ISO 45001 (seit 2018) als Standard für Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement etabliert. ISO 45001 basiert – wie andere Managementnormen – auf dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) und fordert einen risikobasierten Ansatz. In Abschnitt 6.1.2 der ISO 45001 wird verlangt, dass die Organisation fortlaufende Prozesse zur Gefährdungsermittlung und Risikobewertung unterhält. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung müssen schriftlich vorliegen, wie es auch der Gesetzgeber fordert. Entscheidend im Kontext dieser Arbeit: ISO 45001 schreibt ausdrücklich vor, dass die Wirksamkeit der festgelegten Präventionsmaßnahmen überwacht werden muss. Dies kann proaktiv geschehen – etwa durch regelmäßige Kontrollrunden und Audits – oder reaktiv durch Auswertung von Unfällen und Beinahe-Unfällen; im Sinne des Präventionsgedankens wird die proaktive Kontrolle bevorzugt. Damit wird die Wirksamkeitsprüfung quasi zum festen Bestandteil des Managementzyklus (“Check” im PDCA).
Für das Facility Management existiert mit ISO 41001 ebenfalls seit 2018 ein internationaler Standard, der Anforderungen an ein FM-Managementsystem definiert. ISO 41001 zielt zwar primär auf die effiziente und einheitliche Erbringung von Facility-Services ab, betont aber auch Aspekte von Gesundheit, Sicherheit und Risikomanagement im Gebäudebetrieb. So soll ein nach ISO 41001 zertifiziertes FM-System gewährleisten, dass alle relevanten Vorschriften – darunter Arbeitsschutzbestimmungen – eingehalten werden. In der Praxis bedeutet dies, dass ein FM-Dienstleister oder eine FM-Abteilung Prozesse etablieren muss, um z. B. Betreiberpflichten systematisch zu managen (oft spricht man von Compliance im FM). Gefährdungsbeurteilungen und deren Fortschreibung gehören hier dazu. Zwar liefert ISO 41001 keine detaillierten Vorgaben zum Ablauf von Gefährdungsbeurteilungen; jedoch fordert sie, dass Risiken im FM-Betrieb identifiziert und geeignete Maßnahmen implementiert werden, um Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und Nutzer zu schützen. Dies lässt sich in einem integrierten Ansatz ideal durch Verzahnung mit einem ISO-45001-Arbeitsschutzmanagement erreichen. Insofern ergänzen sich ISO 45001 und ISO 41001: Während erstere sicherstellt, dass Arbeitsschutzprozesse (inklusive Wirksamkeitskontrolle von Maßnahmen) zuverlässig laufen, bietet letztere den Rahmen, diese Prozesse in den gesamten Facility-Management-Kontext einzubetten.
Neben den ISO-Standards sind in Deutschland branchenspezifische Regeln wie die GEFMA-Richtlinien (deutscher FM-Verband) oder VDI-Richtlinien relevant. Beispielsweise thematisiert VDI 3810 die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zur Wahrnehmung von Betreiberpflichten – dazu zählt auch das Durchführen und Aktualisieren von Gefährdungsbeurteilungen in der Gebäudetechnik. Auch Normen wie DIN EN 15221 (Vorgängernorm der ISO 41001) und diverse technische Regeln (z. B. DGUV-Regeln, VDMA-Einheitsblätter für Instandhaltung) adressieren indirekt, dass FM-Organisationen die Sicherheit im Betrieb ihrer Anlagen gewährleisten müssen. Zusammen bilden diese Normen und Standards einen Orientierungsrahmen, um Gefährdungsbeurteilungen standardisiert durchzuführen und im Sinne eines Managementsystems zu steuern.
Technische und infrastrukturelle Besonderheiten im Facility Management
Vielfalt der Arbeitsbereiche: Facility Management erstreckt sich von Büroarbeitsplätzen über technische Anlagenräume, Außenanlagen, Lager bis hin zu sanitären und gastronomischen Bereichen. Jede Umgebung bringt spezifische Gefährdungen mit sich – von ergonomischen Problemen an Bildschirmarbeitsplätzen bis zu Absturzgefahren bei Wartungsarbeiten auf dem Dach. Eine einzige Gefährdungsbeurteilung kann meist nicht alle Bereiche abdecken, weshalb ein bereichsbezogener Ansatz nötig ist. Unterschiedliche Teilbereiche müssen separat beurteilt werden, jedoch ohne die Wechselwirkungen aus dem Blick zu verlieren. So kann es z. B. erforderlich sein, separate Gefährdungsbeurteilungen für die Gebäudereinigung, die Wartung der Aufzugsanlagen und den Empfangsbereich zu erstellen – wobei Überschneidungen (etwa gemeinsame Fluchtwege, die von allen genutzt werden) koordiniert betrachtet werden müssen.
Einsatz externer Dienstleister: Im FM sind zahlreiche Aufgaben an Fremdfirmen vergeben (z. B. Reinigungsfirmen, Wartungsdienstleister für Heizung/Klima, Sicherheitsdienste). Rechtlich bleibt der auftraggebende Betreiber aber in der Pflicht, für sichere Abläufe zu sorgen. Das ArbSchG (§8) verlangt bei Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber eine gegenseitige Abstimmung des Arbeitsschutzes. In der Praxis müssen daher auch Fremddienstleister in die Gefährdungsbeurteilung einbezogen werden – entweder indem der Auftraggeber Vorgaben macht oder sich die Bewertungen der Dienstleister vorlegen lässt. Eine Herausforderung ist die Kontrolle der Wirksamkeit bei Fremdfirmen: Hier haben sich regelmäßige Audits und Überprüfungen als Instrument bewährt. Viele Unternehmen vereinbaren mit ihren Dienstleistern Sicherheits-KPIs (z. B. Unfallkennzahlen) und führen eigene Begehungen durch, um sicherzustellen, dass auch externe Mitarbeiter die Schutzmaßnahmen einhalten.
Komplexe technische Anlagen: FM umfasst den Betrieb von gebäudetechnischen Anlagen (Aufzüge, Elektrotechnik, Klima/Lüftung, Feuerlöschanlagen u. a.), die teils überwachungsbedürftig im Sinne der BetrSichV sind. Das bedeutet, dass hierfür regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen oder Sachverständige vorgeschrieben sind. Die Gefährdungsbeurteilung solcher Anlagen muss sicherstellen, dass Prüfintervalle festgelegt sind und Wartungsmaßnahmen rechtzeitig erfolgen, um Ausfälle oder Unfälle zu vermeiden. Die Wirksamkeitsprüfung in diesem Bereich heißt z. B. zu kontrollieren, dass alle vorgeschriebenen Prüfungen fristgerecht durchgeführt wurden und etwaige Mängel tatsächlich beseitigt sind. Hier können moderne Computerized Maintenance Management Systeme (CMMS) oder CAFM-Systeme helfen, indem sie Prüftermine tracken und Nachweise digital dokumentieren. Dennoch bleibt die Herausforderung menschlicher Natur: Die beste Gefährdungsbeurteilung nützt nichts, wenn im Alltag beispielsweise ein defekter Not-Aus-Schalter an einer Maschine nicht gemeldet oder repariert wird. Deshalb muss auch das Meldewesen (Störmeldungen, Unfallanzeigen) als Teil der Wirksamkeitskontrolle funktionieren.
Vielfältige Belegschaft: Im FM arbeiten unterschiedliche Gruppen – festangestellte Haustechniker, Reinigungskräfte (häufig von Fremdfirmen, teils mit Sprachbarrieren), Verwaltungsmitarbeiter, Handwerker auf Zeit, etc. Diese Heterogenität erschwert eine einheitliche Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Unterweisungen und Schulungen müssen zielgruppengerecht erfolgen, um wirksam zu sein. Die Wirksamkeitsprüfung muss daher auch berücksichtigen, ob die Beschäftigten die vorgesehenen Maßnahmen verstanden haben und im Alltag akzeptieren. Hier kommt der Faktor Mensch ins Spiel, einschließlich Sicherheitskultur und Motivation. Beispielsweise nützt eine Regel “Helmpflicht auf der Baustelle” wenig, wenn sie nicht kontrolliert wird und die Beteiligten den Sinn nicht einsehen. Daher sind Verhaltensbeobachtungen und Mitarbeiterbefragungen wichtige ergänzende Methoden, um die Wirksamkeit von organisatorischen Maßnahmen (wie Regeln und Schulungen) zu bewerten.
Die Grundlage für Gefährdungsbeurteilungen im Facility Management ist gesetzlich klar definiert und durch Managementsysteme untermauert. Doch die Komplexität des FM und die Vielzahl von Akteuren machen die Wirksamkeitsprüfung zu einem anspruchsvollen, multidisziplinären Unterfangen. Im nächsten Abschnitt werden konkrete Methoden vorgestellt, mit denen diese Herausforderung angegangen werden kann.
Methoden und Kriterien zur Wirksamkeitsüberprüfung
Dokumentenprüfung und Kennzahlenanalyse: Eine Dokumentenprüfung vergleicht Soll und Ist: Wurden die im Maßnahmenplan der Gefährdungsbeurteilung vorgesehenen Schritte tatsächlich umgesetzt? Beispielsweise kann man Wartungsprotokolle, Prüfberichte und Schulungsnachweise heranziehen. Abweichungen werden so schnell sichtbar (z. B. fehlt ein Nachweis der jährlichen Sicherheitsunterweisung, obwohl im Maßnahmenkatalog gefordert). Zusätzlich geben Kennzahlen (KPIs) Einblick in die Wirkung: Klassische Arbeitsschutz-KPIs sind etwa die Unfallhäufigkeit, die Zahl der Beinaheunfälle oder die Quote erledigter vs. offener Mängelmeldungen. Ein Rückgang der Unfallzahlen nach Einführung bestimmter Schutzmaßnahmen ist ein positives Wirksamkeitsindiz. Allerdings gelten Unfallzahlen als reaktive Indikatoren – sie zeigen erst im Nachhinein, ob Maßnahmen gewirkt haben. Daher werden zunehmend proaktive Kennzahlen genutzt, z. B. Prozent der erledigten Wartungen im Monat (zeigt Präventivpflege) oder Anzahl der Sicherheitsbeobachtungen, die Mitarbeiter melden (zeigt Sicherheitsbewusstsein). Im FM lassen sich auch Compliance-Kennzahlen definieren, etwa „Anteil fristgerecht durchgeführter Prüfungen an technischen Anlagen“. Vorteil von Kennzahlen: Sie ermöglichen Trendanalysen und Benchmarking. Nachteil: Sie vereinfachen die komplexe Realität; eine gute Quote heißt nicht automatisch, dass keine Gefahr mehr besteht (z. B. können keine Unfälle auch Glück oder Untererfassung bedeuten).
Beobachtungen und Begehungen: Die Arbeitsplatzbegehung ist eine direkte Methode, um vor Ort die Umsetzung der Maßnahmen zu überprüfen. Sicherheitsfachkräfte oder Führungskräfte führen regelmäßig Inspektionen durch, bei denen z. B. kontrolliert wird, ob vorgeschriebene Schutzausrüstung getragen wird, ob Absperrungen an Gefahrenstellen vorhanden sind oder ob Ordnung und Sauberkeit eingehalten werden. Solche visuellen Inspektionen sind im FM-Bereich vielseitig anwendbar: von Brandschutzbegehungen (Sind Feuerlöscher und Notausgänge frei zugänglich?) über Wartungsrundgänge (Wurden alle Wartungspunkte gemäß Checkliste erledigt?) bis zur Hygienekontrolle in der Kantine. Typische Kontrollpunkte können dabei sein: Zustand von Fluchtwegen und Sicherheitskennzeichnungen, Umsetzung ergonomischer Verbesserungen am Arbeitsplatz oder die Einhaltung von Zugangsregeln. Die Beobachtung hat den Vorteil, unmittelbare Eindrücke zu liefern und auch implizite Probleme aufzudecken (etwa riskantes Verhalten, das in Dokumenten nicht sichtbar würde). Sie ist relativ flexibel einsetzbar und kann unangekündigt erfolgen, um ein realistisches Bild zu bekommen. Allerdings ist sie stichprobenartig und momentbezogen: Eine Begehung erfasst nur den Zeitpunkt der Kontrolle. Zudem besteht die Gefahr, dass bei angekündigten Audits „geschönt“ wird. Deshalb sind regelmäßige, teilweise auch unangekündigte Begehungen zu empfehlen, um einen breiten Eindruck über die Zeit zu erhalten.
Interne und externe Audits: Audits sind systematische Überprüfungen, oft an einem Prüfkatalog orientiert. Interne Audits werden vom eigenen Personal (z. B. aus der zentralen Arbeitsschutzabteilung oder Qualitätsmanagement) durchgeführt, um die Einhaltung interner Vorgaben und Standards zu checken. Externe Audits erfolgen durch unabhängige Stellen – etwa Auditoren einer Zertifizierungsgesellschaft (bei ISO 45001/41001 Audits) oder durch die Berufsgenossenschaft im Rahmen der Aufsichtsbetreuung. Im Facility Management gewinnen Audits auch hinsichtlich der Fremdfirmenüberwachung an Bedeutung: Ein regelmäßiger Audit- und Überwachungsprozess bei Auftragnehmern hilft, deren Arbeitsschutzstandards zu prüfen und zu verbessern. So kann der FM-Bereich beispielsweise jährliche Lieferantenaudits durchführen, bei denen er checkt, ob der externe Reinigungsdienst die vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Umgang mit Chemikalien, Ausstellen von Warnschildern bei nassem Boden) tatsächlich umsetzt. Audits ermöglichen eine tiefergehende Prüfung anhand von Checklisten und Gesprächen. Sie fördern auch den Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort, was helfen kann, Probleme zu verstehen. Nachteile: Audits sind ressourcenintensiv und erfordern qualifizierte Auditoren. In dynamischen Umgebungen wie FM können starre Auditintervalle (etwa nur einmal jährlich) zu selten sein, um alle Wirksamkeitsprobleme zeitnah zu erkennen. Dennoch sind Audits ein wichtiges Instrument, weil sie systematisch und dokumentiert erfolgen – das schafft Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Wirksamkeitskontrolle.
Befragungen und Feedbackgespräche: Eine oft unterschätzte Methode ist das Einholen von Feedback bei den Mitarbeitern und Nutzern. Die Beschäftigten, die täglich in der betreffenden Umgebung arbeiten, können am besten beurteilen, ob eine getroffene Maßnahme praktisch funktioniert. Daher ist Schritt 6 der Gefährdungsbeurteilung gemäß BAuA-Handbuch ausdrücklich: Überprüfung der Wirksamkeit ggf. durch Beobachten, Messen oder Befragen. Beispiel: Nach Einführung neuer elektrisch höhenverstellbarer Tische (Maßnahme gegen ergonomische Risiken) kann man die Nutzer fragen, ob sie diese auch verwenden und ob sich ihre Beschwerden verbessert haben. Oder wenn eine neue Checkliste für Wartung eingeführt wurde, können die Techniker befragt werden, ob diese verständlich und hilfreich ist. Interviews, Umfragen oder moderierte Workshops liefern qualitative Einblicke und decken eventuell Hindernisse auf (z. B. „Die Persönliche Schutzausrüstung ist vorhanden, wird aber nicht getragen, weil sie unbequem ist“ – ein Hinweis, dass die Maßnahme nicht wirksam ist). Auch die Führungskräfte spielen hier eine Rolle, indem sie im Arbeitsalltag Rückmeldungen geben und ein offenes Ohr für Sicherheitsbedenken haben. Durch Befragungen lässt sich zudem die Sicherheitskultur einschätzen, welche ein wesentlicher Faktor für die Wirksamkeit aller Maßnahmen ist. Die Herausforderung bei dieser Methode liegt in der Subjektivität: Antworten können verzerrt sein (soziale Erwünschtheit) oder nur Momentstimmungen widerspiegeln. Deshalb sollte Feedback immer im Kontext anderer Daten gesehen werden. Trotzdem ist die Einbeziehung der Mitarbeiter wichtig, denn sie fördert zugleich die Akzeptanz der Arbeitsschutzmaßnahmen.
Technische Überwachung und Digitalisierung: Mit fortschreitender Digitalisierung stehen im FM zunehmend technische Hilfsmittel zur Verfügung, um die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen zu überwachen. Ein Beispiel sind Sensoren im Gebäudemanagement: Etwa könnten Sensoren detektieren, ob Notausgangstüren blockiert sind (via IoT-Kontaktsensoren) oder ob Luftqualität und Temperatur in einem Bereich im sicheren Bereich liegen. Auch automatische Prüfstandsanzeigen (z. B. melden moderne Feuerlöscher oder Rauchmelder ihren Status) erleichtern das Monitoring. CAFM-Software ermöglicht es, alle Prüf- und Wartungsaufgaben zentral zu verfolgen und erinnert an fällige Kontrollen. Darüber hinaus kommen mobile Apps zum Einsatz, mit denen Mitarbeiter Gefährdungen melden oder Checklisten digital abhaken können. Die Datenanalyse spielt hier eine wichtige Rolle: Mit ausreichend Datenpunkten könnten FM-Manager Trends erkennen (z. B. an welchen Standorten häufen sich bestimmte Mängel) und so gezielt nachsteuern. Allerdings ist Technik kein Allheilmittel: Sie muss erst implementiert und vernetzt werden, was Investitionen erfordert. Daten müssen korrekt interpretiert werden – ein volles Dashboard ersetzt nicht den Blick vor Ort. Zudem können technische Lösungen auch Fehlalarme generieren oder umgangen werden. Dennoch wird erwartet, dass der Digitalisierungsgrad der Wirksamkeitsprüfung in Zukunft zunimmt, etwa durch Echtzeit-Monitoring kritischer Anlagen und automatisierte Berichte.
Jede der genannten Methoden hat im FM spezifische Stellenwerte. Beispielsweise sind im Bereich Instandhaltung Dokumentenprüfungen (Wartungsnachweise) und technische Sensoren sehr hilfreich, während im Reinigungsmanagement Beobachtungen vor Ort (Sauberkeit, Warnschilder) und Feedback der Reinigungskräfte sinnvoller sein mögen. Im Umgang mit Fremdfirmen sind Audits und KPI-Vereinbarungen gängig, ergänzt durch Stichprobenprüfungen auf der Fläche. Die Methodenkritik zeigt: Kein einzelnes Instrument kann die Wirksamkeit umfassend bewerten; ein Methoden-Mix aus quantitativer und qualitativer Überprüfung führt zum besten Ergebnis. Entscheidend ist, dass diese Überprüfungen fest im Prozess verankert sind – z. B. in Form eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Arbeitschutzmanagement – und dass die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet werden. So entsteht ein Regelkreis, der gewährleistet, dass bei Mängeln nachgesteuert wird (PDCA-Prinzip).
Wirksamkeitsprüfung in verschiedenen FM-Segmenten
Um die zuvor beschriebenen Konzepte greifbarer zu machen, betrachtet dieser Abschnitt exemplarisch, wie die Wirksamkeitsprüfung von Gefährdungsbeurteilungen in unterschiedlichen Bereichen des Facility Managements umgesetzt werden kann. Dabei werden sowohl bewährte Praktiken als auch typische Herausforderungen aus der Praxis beleuchtet.
Betreiberverantwortung und technische Anlagen
Betreiberpflichten im FM umfassen die sichere Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen für Nutzer, Mieter oder Mitarbeiter. In der Praxis bedeutet dies z. B., dass ein FM-Team dafür sorgt, dass Aufzüge regelmäßig geprüft, Brandschutzeinrichtungen funktionstüchtig und Arbeitsmittel sicher sind. Eine Gefährdungsbeurteilung könnte hier etwa ergeben: „Gefahr eines Aufzugsabsturzes oder -einschlusses, Maßnahme: jährliche TÜV-Prüfung plus vierteljährliche Wartung durch Fachfirma“. Die Wirksamkeitsprüfung in diesem Fall besteht zunächst in der Überwachung der fristgerechten Durchführung dieser Prüfungen (Nachweis durch Prüfprotokolle). Viele FM-Organisationen nutzen dafür Prüfterminlisten oder Software, um keinen Termin zu versäumen. Ein weiterer Schritt ist die Kontrolle des Anlagenzustands zwischen den Prüfintervallen: Hier werden z. B. Hausmeister oder Techniker angehalten, bei Rundgängen auf Störungen zu achten (Ölgeruch am Aufzug, ungewöhnliche Geräusche etc.).
In der Praxis hat es sich bewährt, Checklisten für Begehungen zu nutzen, die gezielt auf Betreiberpflichten eingehen. So bietet etwa die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Leitfäden an, welche Prüfpunkte bei der regelmäßigen Anlagenkontrolle zu beachten sind. Ein FM-Leiter berichtete beispielsweise, dass er alle 6 Monate ein internes Compliance-Audit durchführt, bei dem alle prüfpflichtigen Anlagen aufgelistet und der Status der Prüfungen überprüft wird. Dieses Audit deckte in einem Fall auf, dass ein externer Dienstleister die Sprinkleranlagen-Prüfung mehrfach verschoben hatte – ein klarer Wirksamkeitsmangel. Als Reaktion wurden die Verträge angepasst (Pönalen bei Terminverzug) und intern ein automatischer Alarm eingerichtet, wenn ein Prüfprotokoll nicht binnen einer Woche nach Fälligkeit vorliegt. Dieses Beispiel zeigt, wie Kennzahlen (Terminüberschreitung) und Auditelemente zusammenspielen können, um Wirksamkeitslücken zu identifizieren und zu schließen.
Technik ergänzt organisatorische Schutzmaßnahmen
Ein weiteres Beispiel: Im Energiemanagement eines größeren Gebäudekomplexes wurde per Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass hohe Raumlufttemperaturen im Serverraum ein Risiko darstellen (Überhitzung, Ausfall, Brandgefahr). Maßnahme war die Installation eines zusätzlichen Klimageräts plus eines Temperatur-Monitors mit Alarm. Die Wirksamkeitsprüfung hier: Das FM-Team hat einen Sensor installiert, der rund um die Uhr Temperatur misst und per Gebäudeleittechnik meldet. Zudem wurde testweise der Alarm einmal im Quartal ausgelöst, um sicherzustellen, dass die Notfallkette funktioniert (Wartungsfirma rückt aus).
Dies ist ein Beispiel technischer Wirksamkeitskontrolle: Solche technischen Lösungen ermöglichen eine quasi kontinuierliche Überwachung und erhöhen die Sicherheit. Allerdings ergab eine praktische Lehre: Bei einem echten Vorfall (Kühlmittel-Leck) wurde der Alarm an einen Mitarbeiter geschickt, der im Urlaub war – die Kette hakte. Aus dem Feedback wurde gelernt, die Alarmierung redundant auf mehrere Personen aufzuschalten. Hier zeigt sich, dass Technik immer mit organisatorischen Maßnahmen (Vertretungsregelungen etc.) verknüpft betrachtet werden muss.
Instandhaltung und Werkstattbereiche
Im Bereich Instandhaltung (Werkstätten, technische Service-Teams) treten im FM oft die klassischen technischen Gefährdungen auf: mechanische Gefahren bei Reparaturen, elektrische Risiken beim Arbeiten an Anlagen, Gefahrstoffe (z. B. Lösemittel, Öle) oder auch Lärm und Staub. Eine Gefährdungsbeurteilung in einer FM-Werkstatt könnte z. B. Maßnahmen definieren wie: Verwendung von PSA (Schutzhandschuhe, Schutzbrille), Einrichtung eines Absaugungsplatzes für staubige Arbeiten, oder Einführung eines Lockout-Tagout-Verfahrens für elektrische Arbeiten (um versehentliches Einschalten zu verhindern). Die Wirksamkeitskontrolle solcher Maßnahmen erfolgt in der Praxis häufig durch Beobachtung und Unterweisungskontrollen. So berichten viele Sicherheitsingenieure, dass sie regelmäßige Werkstattrundgänge machen, bei denen gezielt geschaut wird: Werden die PSA getragen? Funktionieren die Absaugungen und werden sie benutzt? Sind die Lockout-Tagout-Schlösser im Einsatz, wenn an der Anlage gearbeitet wird? Diese Beobachtungen werden oft mit kurzen Unterweisungsgesprächen kombiniert – man spricht Mitarbeiter direkt an: „Ich sehe, Sie tragen den Gesichtsschutz nicht – gibt es ein Problem damit?“ Solches direktes Feedback hilft, Probleme zu erkennen (vielleicht ist der Gesichtsschutz ungeeignet für Brillenträger, etc.) und sofort nachzusteuern.
Zudem kommen in Instandhaltungsteams gerne Sicherheits-Kurzbesprechungen zum Einsatz (ähnlich „Toolbox-Meetings“). Beispielsweise wird am Wochenbeginn ein 10-Minuten-Treff abgehalten, um Beinaheunfälle oder unsichere Beobachtungen der letzten Woche zu besprechen. Dieser Ansatz – in FM-Werkstätten schon bei manchen Unternehmen etabliert – fördert eine Kultur, in der Wirksamkeitsprüfungen kontinuierlich durch die Mitarbeiter selbst erfolgen. Wenn ein Techniker sagt: „Mir ist aufgefallen, dass beim Schweißen der Funkenflug trotz Schirm zu Problemen führt“, dann wird das im Team diskutiert und ggf. die Maßnahme (Schweißvorhang aufstellen) angepasst. Hier fließt also die Praxisbeobachtung direkt zurück in den Verbesserungsprozess.
Zur objektiveren Kontrolle setzen einige Unternehmen auf interne Audits nach Checkliste. Ein Beispiel: Ein FM-Dienstleister mit bundesweiten Standorten hat ein zentrales HSE-Team, das unangekündigt Werkstatt-Audits macht. Auf ihrer Liste stehen Punkte wie „Ist für jede Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung vorhanden?“, „Wurden die Mitarbeiter zu diesen Gefährdungsbeurteilungen unterwiesen (Nachweis)?“, „Werden die Maßnahmen praktisch umgesetzt (Beobachtung vor Ort)?“. Die Ergebnisse werden in Ampelfarben dokumentiert und an die Standortleiter gemeldet. Durch solche Audits konnte die Firma z.B. feststellen, dass an einigen Standorten zwar Gefährdungsbeurteilungen auf dem Papier existierten, aber kein Mitarbeiter sie kannte – eine eklatante Lücke, die dann mit Nachschulungen geschlossen wurde. Dieses Praxisbeispiel unterstreicht die Wichtigkeit, nicht nur das Vorhandensein von Dokumenten, sondern deren Bekanntheitsgrad und Anwendung abzufragen.
Reinigungsdienste und infrastrukturelle Services
Die Gebäudereinigung ist ein FM-Bereich mit hoher Fremdvergabequote. Typische Gefährdungen hier: Nasse Böden (Rutschgefahr), Umgang mit Chemikalien (Reinigungsmittel), Arbeiten auf Leiter (Fensterputzen), alleine Arbeiten außerhalb der Kernzeiten, etc. Die Gefährdungsbeurteilungen schreiben daher meist vor: Verwendung von Warnschildern „Achtung Rutschgefahr“, Schulung im richtigen Dosieren von Reinigungsmitteln und Tragen von Handschuhen, nur standfeste Leitern verwenden und zu zweit arbeiten bei bestimmten Höhen, Notrufhandys für Alleinarbeit usw. Doch wie stellt man sicher, dass diese Vorgaben im stressigen Alltagsgeschäft tatsächlich eingehalten werden?
In der Praxis haben sich regelmäßige Qualitätskontrollen gekoppelt mit Sicherheitsaspekten bewährt. Beispielsweise führen Objektleiter der Reinigungsfirma Begehungen durch, bei denen sie neben Sauberkeitsgrad auch auf Sicherheitsverhalten achten: Steht das Warnschild, wenn gewischt wird? Werden Reinigungsmittel in den Originalbehältern aufbewahrt (Vermeidung falscher Mischung)? Solche Kontrollen können anhand von Checklisten erfolgen, die abgezeichnet werden. Die FM-Abteilung des Auftraggebers kann dies unterstützen, indem sie z.B. im Dienstleistungsvertrag Sicherheits-KPIs definiert (etwa „max. X Arbeitsunfälle pro Jahr“, „100% Nachweis der Sicherheitsunterweisungen“). Sollte der Dienstleister die KPIs verfehlen, werden Gespräche gesucht und ggf. Vertragsstrafen fällig. Dies ist ein vertraglicher Hebel, der die Wirksamkeitsprüfung incentiviert. Ein reales Beispiel: Ein großes Einkaufszentrum hatte vermehrt Stolperunfälle, weil abends beim Reinigen Kabel von Automaten quer über den Gang lagen. Nach Intervention des FM und Anpassung der Gefährdungsbeurteilung (Maßnahme: Warnleuchten an Kabeln, temporäre Absperrung) wurde im Vertrag festgehalten, dass bei erneutem Vorfall eine Konventionalstrafe fällig wird. Diese klare Ansage motivierte die Reinigungsfirma, intern strenger zu kontrollieren – mit Erfolg: Es traten keine Unfälle mehr auf. Allerdings muss man hierbei beachten, dass reiner Druck von oben nicht immer nachhaltig ist; besser ist die Einbindung der Reinigungskräfte, um praxisgerechte Lösungen zu finden (z. B. andere Reinigungszeiten vereinbaren, um Publikumsverkehr zu vermeiden).
Auch Gesundheitsgefahren (im Sinne von arbeitsbedingten Erkrankungen) sind in infrastrukturellen FM-Bereichen Thema. Zum Beispiel klagen Reinigungskräfte häufig über Rückenschmerzen (von ungünstigen Arbeitsbewegungen) oder Hautreizungen (von Putzmitteln). Wird in der Gefährdungsbeurteilung z.B. die Anschaffung ergonomischer Reinigungsgeräte (mikrOFaser-Mops mit Teleskopstiel) festgelegt, muss die Wirksamkeit kontrolliert werden: Haben die neuen Geräte tatsächlich zu weniger Beschwerden geführt? Hier kann man z.B. nach einem halben Jahr eine Mitarbeiterbefragung machen: „Haben sich Ihre körperlichen Beschwerden verbessert, gleichbleibend, verschlechtert?“. Wenn keine Verbesserung spürbar ist, war die Maßnahme evtl. nicht ausreichend oder falsch umgesetzt (vielleicht wurden die Geräte nicht richtig benutzt, sodass doch wieder gebückt gearbeitet wird). Solches Feedback ist wichtig, um ggf. nachzusteuern – evtl. durch zusätzliche Trainings in ergonomischer Arbeitstechnik oder alternative Hilfsmittel.
Erwähnenswert im Praxisbezug ist auch der Umgang mit psychischen Belastungen, gerade im infrastrukturellen FM (z. B. beim Sicherheitsdienst oder im Kundenservice). Seit einigen Jahren müssen laut ArbSchG auch psychische Gefährdungen beurteilt werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen – z. B. bessere Schichtplangestaltung zur Reduktion von Stress – lässt sich hier meist nur durch dauerhafte Beobachtung von Indikatoren prüfen (Krankheitsquoten, Fluktuation) und durch Gespräche. Das ist ein Feld, wo in der Praxis oft noch Forschungslücken bestehen, weil die Erfolgsbewertung psychischer Präventionsmaßnahmen komplex ist. Ein FM-Unternehmen berichtete z.B., dass es nach Einführung einer Maßnahme gegen psychische Belastung (regelmäßige Teammeetings zur Konfliktklärung) keine sofortigen messbaren Effekte sah – aber in Mitarbeiterumfragen stieg das subjektive Sicherheitsempfinden. Hier gilt es, langfristig dranzubleiben und z.B. nach 1–2 Jahren auf Änderungen zu evaluieren, anstatt vorschnell Maßnahmen als „unwirksam“ abzutun.
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Fremdfirmenmanagement)
Das Fremdfirmenmanagement stellt eine besondere Herausforderung dar, da hier zwei Organisationen (Auftraggeber und Auftragnehmer) beim Arbeitsschutz zusammenspielen müssen. In der Praxis lösen viele große Unternehmen dies durch vertragliche Vorgaben und kontinuierliche Überwachung. Beispielsweise wird oft verlangt, dass Fremdfirmen ein Sicherheitszertifikat vorweisen (wie SCC – Safety Certificate Contractors) oder ein eigenes Arbeitsschutzmanagementsystem haben. Doch auch zertifizierte Dienstleister müssen im Alltag kontrolliert werden.
Wesentlich im Fremdfirmenmanagement sind auch Audits: Wie bereits im Methodenkapitel erwähnt, setzen manche FM-Organisationen regelmäßige Lieferantenaudits auf. Dabei werden dem Dienstleister Fragen gestellt oder vor Ort Kontrollen durchgeführt. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Industriebetrieb ließ jährlich die Firmen auditieren, die seine Maschinen warten. Der Auditkatalog enthielt Fragen wie „Hat die Firma für die Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung erstellt?“, „Wurden die Mitarbeiter entsprechend unterwiesen?“, „Gibt es Aufzeichnungen von Beinaheunfällen während ihrer Tätigkeit bei uns?“. Dieses Audit deckte auf, dass eine kleinere Firma keine schriftlichen Gefährdungsbeurteilungen hatte – man vertraute auf Erfahrung. Als Konsequenz wurden diese Dienstleister angehalten, dies nachzuholen, und der Betrieb bot sogar Unterstützung durch die eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit an.
Dieses Beispiel zeigt, dass Audits als Wirksamkeitsprüfung auch dazu dienen können, das Sicherheitsniveau der Partner zu heben – im Sinne einer partnerschaftlichen Integration der Fremdfirmen.
Nicht zu unterschätzen ist die Überwachung während der Arbeiten: Viele Unfälle passieren trotz aller Vorabmaßnahmen situativ. Deshalb sollte – insbesondere bei gefährlichen Arbeiten (Heißarbeiten, Arbeiten in Höhen, etc.) – eine aufsichtführende Person seitens des Auftraggebers anwesend sein oder zumindest sporadisch nach dem Rechten sehen. In der FM-Praxis gibt es dafür Konzepte wie den „Permit-to-work“-Prozess: Externe müssen sich Arbeitsfreigaben holen, bei denen ein Verantwortlicher prüft, ob alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Die Wirksamkeit wird hier vor der Arbeit geprüft (Prä-Job-Check). Während der Arbeit kann z.B. ein Sicherheitsbeauftragter der FM-Abteilung Stichproben machen – dies schreckt eventuelle Regelverstöße ab und zeigt Präsenz.
Ein Problem in der Praxis ist jedoch oft die Ressource Zeit: FM-Manager sind im Tagesgeschäft eingespannt und können nicht jede Fremdfirma auf Schritt und Tritt kontrollieren. Daher ist ein gestuftes Konzept sinnvoll: Hohe Risiken => engmaschige Kontrolle vor Ort; geringere Risiken => stichprobenhafte Kontrolle kombiniert mit nachträglicher Evaluation (z. B. Feedback vom Auftraggeber der Leistung).
